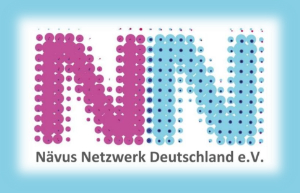Was ist CMN (Congenital Melanocytic Naevi)?
CMN ist eine Abkürzung für Kongenital Melanozytärer Nävus, eine Art Muttermal, das bei Neugeborenen auftreten kann.
Wir haben die häufigsten Fragen zum Thema kongenitaler Nävus und Melanom hier zusammengefasst.
Solltest Du weitere Fragen haben, schreibe uns gern.
Was bedeutet Nävus?
Nävus, der (Plural: Nävi, die) kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Muttermal. Der Begriff wird heute oft mit dem Wort „Leberfleck“ gleichgesetzt. Das führt gelegentlich zu Missverständnissen, denn genau genommen sind Leberflecken eine Untergruppe von Muttermalen, nämlich solche, die durch eine Vermehrung von Pigmentzellen (Melanozyten) entstehen. Man nennt sie auch melanozytäre Nävi, Nävuszellnävi oder Pigmentzellnävi. Daneben gibt es weitere Muttermale, die von anderen Zellen als den Pigmentzellen ausgehen, z.B. Gefäß- oder Feuermale (Naevus flammeus) oder epidermale Nävi, die sich von den Hornzellen der Haut ableiten und oft einen streifenförmigen Verlauf an der Haut zeigen. Wir beschäftigen uns aber hier nur mit melanozytären Nävi, also Leberflecken.
Was bedeutet kongenital?
Der Begriff kongenital kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet angeboren. Kongenitale Nävi sind solche, die bereits bei Geburt bestehen.
Was sind kongenitale Nävi?
Es gibt zwei Arten von melanozytären Nävi, angeborene und erworbene. Erworbene Nävi (Leberflecken) entstehen häufig im Lauf der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter. Bei beinahe jedem Menschen lassen sich einige, manchmal auch hunderte dieser Nävi finden, die meist kleiner als einen halben Zentimeter sind. Angeborene Muttermale variieren hingegen sehr in der Größe, sie können kleiner als 1cm sein, können aber auch ganze Körperteile einnehmen. Bei diesen Personen finden sich oft noch zusätzliche kleinere, sogenannte Satellitennävi, die zum Teil erst nach der Geburt in Erscheinung treten. Darüber hinaus unterscheiden sich Nävi in ihrer Farbe und in ihrer Behaarung (gelegentlich liest man den Begriff Tierfellnävus).
In welche Kategorien werden CMN eingeteilt?
Als große kongenitale Nävi bezeichnet man nach einer häufig gebrauchten Definition Nävi, die beim Erwachsenen größer als 20cm im Durchmesser sind. Um zu einer solchen Größe heran zu wachsen, muss beim Neugeborenen ein Durchmesser von etwa 7 cm vorliegen (bzw. 12 cm am Kopf, da dieser proportional weniger stark wächst). Bei ganz besonders ausgedehnten kongenitalen Nävi spricht man von Riesennävi, die früher auch als Badeanzugnävi bezeichnet wurden, da sie häufig an Rücken und Bauch zu finden sind. Für einen Riesennävus gibt es noch keine weit verbreitete Definition; es wurde vorgeschlagen, diesen Begriff ab einem Durchmesser von 40 cm (beim Erwachsenen) zu verwenden.
Man unterscheidet folgende Größen:
- Kleiner CMN < 1,5 cm
- Mittelgroßer CMN 1,5 – 20 cm
- Große CMN >20 – 40 cm)
- „Riesennävus“ (giant congenital nevus) > 40 cm
Welche Bedeutung hat ein kongenitaler Nävus für einen Menschen?
Zunächst einmal bedeutet es für die Eltern oft einen Schock, wenn ein Kind mit einem großen kongenitalen Nävus geboren wird. Dabei werden zwei Sorgen im Vordergrund stehen: zum Einen die kosmetische Störung, zum anderen die Frage, welche gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind. Je nach Körperstelle und Ausdehnung ist ein großer Nävus in unterschiedlichem Maß den Blicken anderer Menschen ausgesetzt. Viele Eltern befürchten, dass ihr Kind angestarrt wird und sich dadurch nicht normal entwickeln kann. Obwohl in unserer Gesellschaft eine angeborene Fehlbildung nicht mehr als Schande empfunden wird, kann aber auch das Selbstwertgefühl der Eltern erheblich leiden. Außerdem entstehen Fragen wie: Habe ich etwas falsch gemacht? Hätte man die Entstehung des Nävus verhindern können? Natürlich richten sich sehr viele Hoffnungen auf eine Therapie. Neben einer Beratung durch Ärzte oder Psychologen kann der Kontakt mit anderen betroffenen Eltern bzw. erwachsenen Nävusträgern besonders beim Umgang mit der Situation helfen.
Bei der Frage nach den möglichen medizinischen Folgen muss erst einmal betont werden, dass ein großer kongenitaler Nävus meistens eine isolierte Fehlbildung darstellt, also weder mit einer geistigen Behinderung noch mit Fehlbildungen an anderen Organen einhergeht. Menschen mit großen kongenitalen Nävi haben eine völlig normale Lebenserwartung. Trotzdem gibt es zwei wichtige, zum Glück seltene Komplikationen: erstens kann sich etwas häufiger als bei der Allgemeinheit ein bösartiger Hautkrebs (Melanom) entwickeln, daher muss der Nävus in regelmäßigen Abständen hautärztlich untersucht werden. Zweitens können Pigmentzellen nicht nur in der Haut sondern auch in den Hirnhäuten vermehrt zu finden sein. Man spricht von einer neurokutanen Melanose. Diese kann durch eine Kernspintomographie, ein röntgenstrahlenfreies Bildgebungsverfahren, bereits im Säuglingsalter erkannt werden. Menschen mit neurokutaner Melanose können symptom- und beschwerdefrei sein, es können sich aber auch unheilbare, gelegentlich lebensbedrohliche Störungen im Gehirn entwickeln.
Was sind Melanozyten
Der Begriff Melanozyt kommt aus dem Griechischen und bedeutet schwarze Zelle. Melanozyten stellen das Pigment Melanin her, das den Körper vor UV-Strahlung schützt und dafür sorgt, dass die Haut ihre Farbe erhält. Beim Embryo befinden sich Vorläuferzellen von Melanozyten in der Neuralleiste, d.h. in der Nähe des späteren Rückenmarks. Unter dem Einfluss von körpereigenen Botenstoffen fangen sie aber bereits im zweiten Schwangerschaftsmonat an, in Richtung der Haut zu wandern.
Wie entstehen kongenitale Nävi?
Die Zellen, aus denen sich ein Nävus aufbaut, die sogenannten Nävuszellen, sind veränderte Melanozyten. Sie stellen oft besonders viel Melanin her, so dass die Haut im Nävus dunkler aussieht als die normale Haut. Bei der Entstehung von kongenitalen Nävi kommt es zu einer stärkeren Vermehrung und gestörten Verteilung von embryonalen Melanozytenvorläuferzellen. Die Ursache hierfür ist noch nicht genau bekannt. Man geht von einer genetischen Veränderung (Mutation) aus, die erst nach der Zeugung, d.h. der Vereinigung von Ei- und Samenzelle, ausgelöst wird und daher nur einen Teil der Körperzellen des Embryos (nämlich bestimmte Zellen der oben genannten Neuralleiste) betrifft. Als Folge kommt es auch nur in den Zellen, die sich durch Teilung von diesen ursprünglich veränderten Zellen ableiten, zu der entsprechenden Fehlentwicklung. Daher sind kongenitale Nävi nicht vererbbar. Das heißt, dass Eltern eines Kindes mit einem kongenitalen Nävus weder befürchten müssen, dass ein weiteres ihrer Kinder eine ähnliche Hautveränderung bekommen könnte, noch dass das Kind mit dem Nävus diese Eigenschaft an seine Nachkommen weitergeben wird.
Wie häufig sind Nävi?
Kongenitale Nävi treten bei beiden Geschlechtern und sowohl bei Weißen als auch bei Farbigen auf, wobei sie bei Mädchen etwas häufiger sind (Verhältnis ca. 1,2 zu 1). Die meisten Babys kommen ohne Nävi zur Welt, kleine Nävi finden sich aber bereits bei ca. 1% der Neugeborenen. Größere Nävi (größer als 10cm bei Geburt) haben eine geschätzte Häufigkeit von 1:20.000, d.h., jeder 20.000ste wird mit einen solchen Nävus geboren. Riesennävi sind noch deutlich seltener, hier wird eine Häufigkeit von 0,5 bis 1:100.000 Geburten geschätzt, d.h., dass in ganz Deutschland nur wenige hundert Personen mit dieser Art von Nävi leben. Leider ist es bisher noch nicht möglich, genauere Angaben über die Häufigkeit kongenitaler Nävi zu machen, da diese Fälle nicht statistisch erfasst werden. Um genauere Aufschlüsse über die Häufigkeit zu bekommen, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Träger eines kongenitalen Nävus in einem landesweiten Register eintragen, welches Dr. Krengel führt.
Wenn sie die Erforschung von CMN unterstützen wollen, können Sie hier den Fragebogen ausfüllen.
Wurden schon immer Kinder mit Muttermalen geboren?
Soweit bekannt ist, ja. Der möglicherweise erste Hinweis auf kongenitale Nävi findet sich im Buch Genesis in der Bibel (1. Buch Mose 25,25), wo die Geburt der Zwillinge Jakob und Esau, der Söhne von Isaak und Rebecca, beschrieben wird:
Der erste, der kam, war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt wie mit einem Fell. Man nannte ihn Esau. Dieser Beschreibung nach ist es möglich, dass Esau einen rötlichen, haarigen Tierfellnävus hatte. Die ersten medizinischen Beschreibungen von kongenitalen Nävi stammen aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.
Warum sieht die Haut über einem kongenitalen Nävus häufig nicht nur dunkel, sondern auch “komisch” aus?
Die Dichte der Pigmentzellen unter der Haut ist bei größeren Nävi oft nicht ganz gleichmäßig über den Nävus verteilt. Daher kommt es zu einer ungleichmäßigen Hautbeschaffenheit. Die Haut über kongenitalen Nävi ist z.B. oft etwas verdickt oder runzelig. Dieser Effekt kommt durch eine starke Pigmentzellvermehrung direkt unter der Hautoberfläche zustande. In einigen Fällen, häufiger am Rücken oder am Po, erscheint die Haut unregelmäßig gebuckelt. An diesen Stellen liegen umschriebene, besonders ausgeprägte, knotige Vermehrungen von Pigmentzellen vor. Unter einem Nävus können gelegentlich auch andere gutartige Knoten liegen, z.B. Lipome (Fettgewebsgeschwulste) oder Neurofibrome (spezielle, gutartige Bindegewebstumoren).Warum schwitzt man an den Stellen mit einem Nävus anders?
Die Schweißdrüsen sind in einem Nävus zum Teil nicht so ausgebildet wie in normaler Haut. Personen mit großen Nävi schwitzen zum Ausgleich auf der normalen Haut mehr, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Dann ist die normale Haut sehr feucht, während die Nävushaut eher trocken bleibt.
Warum neigt die Nävushaut manchmal zu Trockenheit und Juckreiz?
Auf Nävushaut gibt es oft weniger Talgdrüsen, die die Haut feucht und geschmeidig halten. Zudem gibt es in Nävi vermehrt Mastzellen, die für die Entstehung von Juckreiz verantwortlich sind. In ausgeprägten Fällen kann mittels Einnahme eines Antihistaminikums der Juckreiz gestillt werden. Gegen die Trockenheit hilft eine gründliche Hautpflege mit Pflegecremes für trockene Haut, vor allem nach dem Baden oder Duschen. Außerdem sollten, falls erforderlich, keine Seifen sondern allenfalls pH-neutrale Duschgele verwendet werden (ph5 bzw. 5,5).
Müssen sich Patienten mit einem kongenitalen Nävus besonders vor der Sonne schützen?
Die Gefahr der Entwicklung von Hautkrebs auf einem kongenitalen Nävus wird weiter unten genauer besprochen. Auch wenn es keine sicheren Hinweise gibt, dass Menschen mit angeborenen Pigmentmalen stärker als andere gefährdet sind, durch Sonnen- bzw. UV-Licht Hautkrebs zu bekommen, sollte die Nävushaut bei sonnigem Wetter immer mit Kleidung bedeckt oder zumindest mit einer wirksamen Sonnenmilch bzw ‑creme (Lichtschutzfaktor 40–60) eingecremt werden. Solarien sollten nicht besucht werden (das gilt auch für alle Menschen ohne Nävus, die ihre Haut länger glatt und jugendlich erhalten wollen!).
Verändern sich kongenitale Nävi?
Kongenitale Nävi verändern sich oft leicht im Laufe des Lebens, in sehr seltenen Fällen wurde sogar von einer spontanen Rückbildung berichtet. Man vermutet, dass in diesen Fällen das Immunsystem des Patienten die veränderten Zellen erkannt und zerstört hat. Bei allen Nävi kann sich mit der Zeit die Farbe verändern; der Nävus wird häufig in den ersten zehn Lebensjahren deutlich heller, in selteneren Fällen auch dunkler. Große Nävi haben oft von Geburt an eine etwas ungleichmäßige Farbverteilung. Das ist nicht schlimm. Entsteht in einem kongenitalen Nävus eine einzelne dunklere Stelle, sollte sie einem Hautarzt gezeigt werden (auch wenn es sich meistens um eine harmlose Veränderung handelt). Neu auftretende Knoten, nicht-heilende Wunden oder andere, rasche Veränderungen, sollten auf jeden Fall zur Vorstellung bei einem Hautarzt zum Ausschluss eines malignen Melanoms (schwarzer Hautkrebs) führen. Der Hautarzt wird dann evtl. aus dem verdächtigen Bezirk eine Gewebeprobe in örtlicher Betäubung entnehmen. Auf diese Weise kann das Wesen der Veränderung durch eine mikroskopische (histologische) Untersuchung eindeutig geklärt werden. In den letzten 10–15 Jahren wurde das Krankheitsbild „Proliferierender Knoten auf kongenitalem Nävus“ genauer erforscht. Es handelt sich um einen (manchmal auch mehrere) Knoten, die auf einem großen kongenitalen Nävus im Kindesalter wachsen. Diese Knoten sind gutartig, werden aber auch von Histologen manchmal mit einem Melanom verwechselt. Es gibt mittlerweile sehr moderne Laboruntersuchungen, um in solchen Fällen Klarheit zu schaffen.
Wie bzw. wie oft sollte ein kongenitaler Nävus untersucht werden, wenn er nicht exzidiert wird?
Zuhause sollte man einen (großen) kongenitalen Nävus ungefähr einmal im Monat gründlich untersuchen, zudem sollte man sich alle sechs bis zwölf Monate bei einem Hautarzt vorstellen. Zusätzlich ist es besonders hilfreich, wenn der Nävus fotografiert wird. Viele Hautärzte haben dafür spezielle Dokumentationssysteme, bei denen der Verlauf genau gespeichert werden kann. Aber auch mit einer normalen Digitalkamera kann man die Entwicklung eines Nävus gut selber dokumentieren. Hautärzte verfügen meistens auch über ein sogenanntes Auflichtmikroskop. Mit diesem Gerät kann mit 20–40facher Vergrößerung schmerzlos eine Aufnahme von Anteilen des Nävus gemacht werden, die besonders gut kontrolliert werden sollen. Alle diese Maßnahmen können helfen, Veränderungen rechtzeitig zu erkennen. Außerdem können sie verhindern, dass unnötige Biopsien aus einem Nävus genommen werden, weil man unsicher ist, ob sich eine bestimmte Stelle verändert hat.
Wie groß ist das Risiko, dass Hautkrebs entsteht?
Zunächst muss man diese Frage präzisieren: Es existieren in der allgemeinen Bevölkerung verschiedene Arten von Hautkrebs (am häufigsten ist der „helle Hautkrebs“, das Basaliom). Von diesen verschiedenen Arten ist für kongenitale Nävi nur das maligne Melanom (auch: „schwarzer Hautkrebs“) relevant. Aber auch zum Melanomrisiko gibt es aufgrund der unvollständigen Erfassung von Patienten mit kongenitalen Nävi keine ausreichenden Daten. Das statistisch errechnete Melanomrisiko für einen einzelnen Menschen mit kongenitalem Nävus schwankt je nach Studie zwischen 0,05 und ca. 10% (Krengel_2006). Allerdings wird zunehmend klar, dass das Risiko in früheren Studien oft deshalb so hoch angegeben wurde, weil sich Fälle, in denen ein Melanom entstand, den behandelnden Ärzten besser einprägten und sie daher auch eher in der Literatur berichtet wurden. Mittlerweile zeigt sich, dass das Risiko für Melanomentwicklung stark von der Größe des Nävus abhängt und besonders bei Nävi über 40 cm Durchmesser erhöht ist. Neuere Schätzungen gehen jedoch selbst für solche Riesennävi von einem Risiko um ca. 5% aus, im Verlauf des Lebens ein Melanom zu entwickeln. Auf jeden Fall ist das Melanomrisiko in großen bzw. besonders in Riesennävi gegenüber dem Durchschnitt erhöht. Um bessere statistische Daten zu erhalten, ist es erforderlich, Patienten möglichst schon im Säuglingsalter in einem Register zu erfassen, um dann zuverlässigere Angaben über den Verlauf zu erhalten.
Was ist ein Melanom?
Ein Melanom ist ein bösartiger Tumor der Haut, der durch Entartung von Melanozyten entsteht. Bösartig bedeutet, dass dieser Tumor unkontrolliert wächst und dabei das umgebende Gewebe zerstören kann. Dieses Wachstum kann relativ langsam über Monate erfolgen, in einzelnen Fällen aber auch sehr rasch (innerhalb von Wochen). Die größte Gefahr besteht darin, dass sich entartete Zellen vom Tumor ablösen und über Blut- oder Lymphbahnen in andere Organe bzw. in Lymphknoten gelangen und dort sogenannte Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden.
In welchen Nävi kann ein Melanom entstehen?
Kleinere kongenitale Nävi sind eher als harmlos einzustufen, es ist umstritten, ob sie überhaupt ein höheres Entartungsrisiko als erworbene Nävi haben. Bei den meisten Fällen, in denen ein Melanom auf einem kongenitalen Nävus entstand, handelte es sich um kongenitale Riesennävi. Bei diesen Kindern kann sich ein Melanom in seltenen Fällen bereits in der Kindheit entwickeln. Wichtig ist, dass ein Melanom in Riesennävi auch von etwas tieferen Hautschichten (z.B. dem subkutanen Fettgewebe) ausgehen kann und sich dann eher tasten als sehen lässt. Daher sollten solche Nävi auch regelmäßig abgetastet werden. Andererseits sind Veränderungen in einem kongenitalen Nävus gerade in Kindheit und Jugend relativ häufig und in den meisten Fällen harmlos. Wenn sich Veränderungen in der Farbe oder in der Oberflächenbeschaffenheit zeigen oder wenn der Nävus nässt oder blutet, sollte in jedem Fall, auch bei kleineren Nävi, eine Vorstellung bei einem Hautarzt erfolgen, um ein Melanom auszuschließen.
Kann man auch ohne einen kongenitalen Nävus an einem Melanom erkranken?
Ja, das Melanom ist der bei weitem bösartigste, wenn auch nicht der häufigste Tumor der Haut und einer der häufigsten Tumoren überhaupt. Es tritt in Deutschland bei ca. 12–15 pro 100.000 Menschen im Jahr auf. Der größere Teil (ca. 70–80%) der Melanome entsteht durch Entartung von Melanozyten in völlig normaler Haut. Etwa 20–30% der Melanome entstehen auf Nävi, aber normalerweise auf solchen, die nach der Geburt enstanden sind. Da kongenitale Nävi sehr selten sind, sind sie nur für einen sehr kleinen Teil der Melanome verantwortlich.
Umgekehrt haben aber Träger eines großen kongenitalen Nävus ein gegenüber der Allgemeinheit erhöhtes Entartungsrisiko (=relatives Risiko). Da bei kongenitalen Nävi ein Melanom bereits im Kindes- oder Jugendalter auftreten kann (was für Melanome ansonsten sehr selten ist), ist das dieses relative Risiko für Kinder mit Riesennävi gegenüber anderen Kindern sogar deutlich erhöht. Für den einzelnen Menschen ist aber das sogenannte absolute Risiko, das oben besprochen wurde, entscheidend.
Kann ein Melanom geheilt werden?
Wenn ein Melanom früh entdeckt und entfernt wird, ist die Heilungschance sehr gut. Wird es hingegen zu spät entdeckt oder ignoriert, ist die Gefahr groß, dass sich veränderte Krebszellen bereits überall im Körper abgesiedelt haben. Es gibt zurzeit keine Möglichkeit, dies zu verhindern. Selbst durch Entfernung kompletter großer Nävuszellnävi kann das Risiko für ein Melanom nicht auf Null absinken, weil es oft unmöglich ist, alle veränderten Zellen zu entfernen.
Vermindert eine chirurgische Entfernung das Risiko, dass in einem großen kongenitalen Nävus ein Melanom entsteht?
Zunächst scheint die Antwort klar: Pigmentzellen, die entfernt wurden, können nicht mehr entarten. Allerdings zeigen neuere Untersuchungen, dass sich Melanome bei KMN insgesamt relativ selten bilden und zwar überwiegend bei Patienten mit Riesennävi (über 60 cm Erwachsenendurchmesser). Zudem ist das Risiko bei Patienten mit Beteiligung von Gehirn und Rückenmark erhöht (neurokutane Melanose). Von den Melanomen, die sich in diesen beiden Gruppen bilden, entsteht vermutlich nur ca. die Hälfte an der Haut, die andere Hälfte direkt im Gehirn. Mithin ist die vorbeugende Wirkung einer (bei Riesennävi sehr aufwendigen) operativen Entfernung limitiert. Abgesehen davon ist eine vollständige Entfernung ja gar nicht in jedem Fall möglich. Es wurde sogar berichtet, dass einzelne Patienten trotz nahezu kompletter Entfernung eines Riesennävus dennoch später ein Melanom entwickelten. Das alles sollte bei der Entscheidung für oder gegen eine Operation bedacht und genau mit den behandelnden Hautärztinnen bzw. Chirurginnen besprochen werden. Bei kongenitalen Nävi mit verdickten, buckeligen oder faltigen Anteilen kann eine Entfernung zumindest dieser Stellen dazu beitragen, den gesamten Nävus besser kontrollieren zu können.
Die aktuellen Empfehlungen besagen, dass die Entscheidung für oder gegen eine chirurgische Therapie nicht durch die Angst vor einem Melanom motiviert sein sollte, sondern von der Einschätzung, ob mit einer vertretbaren Belastung für das Kind eine deutliche Verringerung der sichtbaren Auffälligkeit gelingen kann. Die Verringerung der Stigmatisierung, nicht die Melanomprophylaxe, ist das Ziel der chirurgischen Therapie. Es gibt keine “Entfernung um jeden Preis”!